Corpsstudenten engagieren sich im Widerstand gegen Kommunismus und Unfreiheit, gegen die Mauer
Berlin 1966. – Seit fünf
Jahren teilt eine Mauer die Stadt, die unzählige Familien und Paare
getrennt hat. Der westdeutsche Jurastudent Volker G. Heinz, Inaktiver
des Corps Suevia Heidelberg, hat eine Mission. Er gehört zu einer Gruppe
von Fluchthelfern, die mit festem Glauben an die Freiheit, mit großer
Kaltblütigkeit und unerschütterlichem Mut Menschen über die Schandmauer
von Ost nach West bringt.
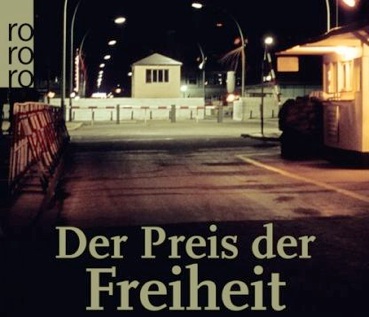
Der Mauerbau hat es 1961
grell und schlaglichtartig gezeigt: Berlin ist Frontstadt im Kalten
Krieg. Dramatische Szenen am Checkpoint Charlie, dem bestbewachten
Grenzübergang des Kalten Krieges, tränenüberströmte Gesichter im
S-Bahnhof Friedrichstraße, entsetzliche Bilder von erschossenen Menschen
im Stacheldraht der Grenzsperren – es gibt sie wieder und wieder. Genau
die wollen die Fluchthelfer verhindern. Sie sind Vorkämpfer der
Freiheit, aber diejenigen der DDR-Bürger, die mit ihrer Unterstützung
dem kommunistischen Regime entfliehen, sollen stattdessen ohne Aufsehen
über die Grenze geschleust werden. Zu den Erfindern dieser Methode
gehört Volker Heinz, selbst ein angehender Jurist, einer mit großem
Gerechtigkeitssinn. In Berlin hat er von Kommilitonen gehört, dass die
Tunnelbauten der ersten Jahre nach dem Mauerbau zu aufwendig, zu
auffällig und auch zunehmend zu unsicher geworden seien. Eine neue Idee
mußte her! In der Kerntruppe der Fluchthelferzelle, für die Volker Heinz
tätig ist, sind mehrere Corpsstudenten aktiv. Speziell sie wissen
besser als manch Anderer, wie Risiken einzuschätzen, wie unter Gefahr
für Leib und Leben sichere Schritte zu gehen sind.
Ein syrischer Diplomat mit
seinem weißen Mercedes unterstützt die arkan operierenden Fluchthelfer.
Das Auto ist durchaus standesgemäß und im übrigen unauffällig. Doch das
Innenleben dieses Diplomatenfahrzeugs ist umgebaut – präpariert für die
Schleusung von Menschen. 66 DDR-Bürger schleusen Heinz und seine
Mitverschwörer im Jahre1966 nach und nach durch die Grenzkontrollen an
der Berliner Mauer, eine im Bildteil wiedergegebene Auflistung von der
Hand eines Stasi-Offiziers belegt das. Immer wieder gelingt so die
Flucht vor dem kommunistischen und menschenverachtenden SED-Regime,
versteckt im Kofferraum dieses syrischen Diplomatenautos. Erstaunen,
dass das so lange gut gehen konnte: das empfindet der Leser.
Die Erinnerungen lassen den
mutigen und couragierten Fluchthelfer auch 50 Jahre nach seiner
Inhaftierung und Verschleppung durch die DDR-Staatssicherheit nicht los.
Entstanden ist ein detailreich und flüssig geschriebenes Buch – packend
wie ein Krimi von John le Carré. Das Deutschlandradio Kultur, dem er
ein langes Interview gab, über Volker Heinz: „Er selbst beschreibt sich,
den westdeutschen Jurastudenten, als Idealisten und Abenteurer. In
Wuppertal aufgewachsen, hatte der 22-Jährige gerade zwischen
Studienaufenthalten in Heidelberg und Bonn zwei Semester in Berlin an
der Freien Universität belegt, als er zufällig in die Fluchthelferszene
geriet.“
Heinz ist kreativ, er hat
Erfolg mit der Umsetzung seiner neuen Idee. In seinem Buch beschreibt er
genau, glorifiziert nicht, lässt aber auch nichts weg. Doch er lebt
gefährlich; daß er als westdeutscher Tagesbesucher immer wieder
einreist, fällt offenbar auf. Daß er Fluchtaktionen an Ostberliner
Treffpunkten betreut, bleibt dagegen zunächst unentdeckt. Doch die
misstrauische Staatssicherheit läßt insgeheim ein- und ausreisende
Diplomatenautos in Serie optisch vermessen, darunter auch das syrische.
So schöpfen die Stasi-Offiziere im besonderen Einsatz (OibE) an der
Grenze Verdacht, observieren – und stellen Volker Heinz eine Falle.
Der Student wurde verhaftet
und monatelang im Untersuchungsgefängnis in Hohenschönhausen immer
wieder von Stasi-Offizieren verhört. Isolation und Langeweile setzten
ihm zu. Mit sportlicher Fitness und mentalem Zeitvertreib versuchte er,
depressive Stimmungen auszugleichen, um ja nicht durch Verhöre und
Gefängnisalltag gebrochen zu werden. In einem Scheinprozeß wurde er
schließlich zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt, weil er „fortgesetzt
Personen zum illegalen Verlassen der DDR verleitet“ habe. Das Urteil war
ein Schock. Nur die Tatsache, dass zuvor schon der Ost-Berliner Anwalt
Wolfgang Vogel signalisiert hatte, er solle guten Mutes sein, ließ den
Häftling sein Schicksal ertragen. Die Andeutungen des Anwalts konnten
nur eines heißen: daß sein Fall dort bekannt war, wo geholfen werden
konnte, bei seinem Corpsbruder Hanns Martin Schleyer und bei einem
anderen Corpsbruder, dem Staatsminister im Bundeskanzleramt, Werner
Knieper.
50 Jahre danach beschreibt
der Autor das gesamte Geschehen. Es hat ihn nicht losgelassen, das ist
erkennbar. Das ist an der Schilderung seiner Fluchthelfer-Tätigkeit
ebenso wie an der fast quälend ausführlichen, aber ganz nüchtern und
sachlich formulierten Wiedergabe seiner Haftbedingungen und des
Prozesses, der ihn erwartete, deutlich zu erkennen. Erstmals konnten
übrigens die juristischen Hintergründe in einem Buch an einem realen
Fall beleuchtet werden – konkret: die Dialoge und Schriftsätze des
DDR-Anwalts Wolfgang Vogel und seines Kollegen auf der Westseite, Jürgen
Stange.
Erst seit 2014 sind diese
Akten überhaupt zugänglich, und es ist höchst interessant, das
juristische Tauziehen zu beobachten. Heinz bietet, aus diesem
Blickwinkel betrachtet, also echte Novitäten. Und das Gebiet, das durch
ihn hier erstmals von der narrativ-anschaulichen Seite her betreten und
geschildert wird, ist wahrlich groß: es geht um nicht weniger als drei
Milliarden D-Mark für rund 30.000 politische Gefangene, die die
Bundesrepublik aus den Gefängnissen der DDR hinauskaufte. Volker Heinz
war hier einer der ersten, und er wurde gegen eine hohe Summe Bargelds
und zwei russische Spione getauscht, deren Freilassung eigentlich der
DDR gar nichts brachte. Was als Nebenaspekt auch einmal mehr belegt, wie
abhängig der DDR von der übermächtigen Sowjetunion war. Daß Heinz so
hoch bestraft und bald danach gegen zwei Spione ausgetauscht wurde, war
in den 1960er Jahren noch ungewöhnlich.
Zwölf Jahre seines Lebens
im Stasi-Knast und in Zwangsarbeit nach Art eines kommunistischen Gulag –
das blieb Volker Heinz erspart. Obschon er letztendlich in relativ
kurzer Zeit aus der Sache herausgekommen ist, haben Fluchthilfe,
Verhaftung und kommunistische Gewalt bei ihm Spuren hinterlassen. Selbst
als erfahrener Rechtsanwalt in Berlin und London kehrte er später nur
mit unguten Gefühlen als Besucher ins Berliner Gerichtsgebäude oder in
die Haftanstalt Hohenschönhausen zurück. Und doch hat er seine
Entscheidung für das Engagement gegen den Kommunismus nie bereut.
Der Preis war hoch. Heinz
hat ihn bezahlt. Das bei Rowohlt erschienene Taschenbuch enthält ein
packendes Stück erlebte Zeitgeschichte über Fluchthilfe und
Gefangenenaustauch im Kalten Krieg, über Freiheitswillen und
Zivilcourage; es ist so spannend zu lesen wie ein Krimi. Es ist dabei
auch ein Stück Studentengeschichte, denn überall dort, wo es um die
Freiheit ging, waren in diesem Lehrstück der Zeitgeschichte
Corpsstudenten beteiligt. Der Autor selbst wurde von einer Gruppe
bereits in der Fluchthilfe engagierter Corpsstudenten dazu angeregt,
Fluchthelfer zu werden; er sorgte unter anderem dafür, dass mehrere
Corpsbrüder aus der Unterdrückung fliehen konnte, und zwei andere
Corpsbrüder – der eine mit einem großen Geldbetrag, der andere als
Staatsminister der Bundesregierung – sorgten nach seiner Inhaftierung
und Verurteilung dafür, daß seine Freilassung überhaupt Realität werden
konnte.
Es gibt viele Geschichten
über den Widerstand von Korporierten gegen den Kommunismus. Sie beginnen
im zuweilen wenig rühmlichen Umfeld der 1920er Jahre und sie ziehen
sich durch bis zum Fall des Eisernen Vorhangs. Volker Heinz und seine
Mitstreiter stehen dabei für einen Glanzpunkt an Mut und Menschlichkeit
in einer langen Auseinandersetzung, die den Großteil des 20.
Jahrhunderts durchzieht. Dieses Buch stellt einen großen Gewinn dar,
denn es hebt ein Kapitel aus dieser langen Widerstandsgeschichte
exemplarisch ans Licht – und das im Stil
der hervorragenden, narrativen Geschichtsschreibung, wie sie vor allem
im anglo-amerikanischen Raum gepflegt wird. Ein unbedingt lesenswertes
Werk aus dem namhaften Rowohlt-Verlag, das zudem dankenswerterweise sehr
erschwinglich ist.
Volker G. Heinz, Der Preis der Freiheit – Eine Geschichte über Fluchthilfe, Gefangenschaft und die geheimen Geschäfte zwischen Ost und West, Reinbek bei Hamburg 2016, TB 238 Seiten, achtseitiger s/w-Bildteil, ISBN 978-3-499-63176-4, Euro 9,99.
Leseprobe: Volker G. Heinz, Der Preis der Freiheit:
Hinter mir lagen drei
ereignisreiche Semester Jura in Heidelberg – ich hatte im Kneipsaal
unseres Anfang des vergangenen Jahrhunderts erbauten Corpshauses viel
gesungen und viel getrunken, mit der blanken Waffe gefochten, schöne
Reisen unternommen und kaum studiert – , aber nun, im Frühjahr 1965,
wollte ich raus aus dem feuchtfröhlichen Umfeld, etwas anderes erleben,
vor allem aber ernsthaft studieren. Wie so viele in dieser Zeit zog es
mich nach Berlin, und die Regierung in Bonn subventionierte in der
geteilten Stadt zwei Besuchssemester. Diese Chance wollte ich mir nicht
entgehen lassen. Berlin, das klang in meinen Ohren nach Abenteuer und
Freiheit. (…)
In der Argentinischen Allee
1 in Zehlendorf, nur eine kurze Autofahrt von der Freien Universität
entfernt, bezog ich ein kleines Pensionszimmer und sah mich in den
kommenden Tagen und Wochen in der „Frontstadt“ Berlin um. Die Lage war
nicht ohne politische Brisanz, sowohl die Sowjetunion als auch die USA
sahen ihren Teil Berlins als Speerspitze im Kampf gegen das System des
jeweils anderen. Von beiden Seiten wurde geschnüffelt, erpresst,
intrigiert, eingeschüchtert und hintergangen. Laute Propaganda auf
beiden Seiten war ein Teil des Berliner Lebens, und die politisch
angespannte Situation war überall zu spüren. Immer wieder ging ich bei
meinen Spaziergängen durch die Stadt an der hässlichen Mauer entlang,
die fast 200 Straßen getrennt oder verstümmelt hatte – was für ein
Kontrast zum beschaulichen Heidelberg, dem Juwel badischen Frohsinns.
Ich hatte mich an der
Freien Universität für Volkswirtschaft und Jura eingeschrieben. Die noch
junge Universität wurde im engen Zusammenhang mit dem beginnenden
Ost-West-Konflikt als Gegenstück zur Berliner Humboldt-Universität
gegründet und war von einer sehr politischen Studentenschaft geprägt.
Neben meinen ausgiebigen Stadterkundungen suchte ich nach geselligem
Anschluss. In Heidelberg, wo ich zuvor studiert hatte, gehörte ich der
ältesten studentischen Verbindung an, dem Corps Suevia. Es wurde 1810
gegründet und war, wie viele andere Verbindungen, letztlich ein Kind der
Französischen Revolution und der deutschen Freiheitsbewegung.
Mich reizte als junger Mann
die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die Wert auf Solidarität und
Geselligkeit legte. Im Berliner Stadtteil Dahlem, in der
Hammersteinstraße, befand sich das Haus einer Schwesterverbindung, der
Lusatia Leipzig zu Berlin. Als Mitglied eines Corps konnte man das
Netzwerk der deutschlandweit verbreiteten Schwestercorps in Anspruch
nehmen. In der Lusatia schloss ich auch schnell Freundschaften, unter
anderem mit Manfred Baum. Ich hatte allerdings keine Ahnung, welche
außergewöhnlichen Folgen diese Begegnung für mein Leben noch haben
sollte.
Eines Tages, ich war gerade
drei oder vier Monate in Berlin, saß ich bei Manfred, einem
hochgewachsenen Mann mit dunkelblonden Haaren und blaugrauen wachen
Augen, in seiner Studentenwohnung in der Köhlerstraße in
Lichterfelde-West. Das Gebäude war kein typisches Berliner Mietshaus,
eher ein Vorstadthaus in einer Gegend, in der viele Arbeiter und
Eisenbahner lebten. Das Ehepaar Ahrens wohnte im ersten Stock, die
Souterrainräume vermieteten sie an Studenten. Manfred studierte Medizin.
Ihn schien seit einiger Zeit etwas zu bedrücken, aber ich hatte noch
nicht herausgefunden, was es war, und ich wollte ihn auch nicht
bedrängen.
Während Manfred das Wasser
für einen Kaffee zum Kochen brachte, griff ich wahllos zu einer
Illustrierten, die auf dem Tisch lag. Es war der Stern. Irgendwo in der
Mitte schlug ich das Magazin auf. Vor mir sah ich eine bunte
Fotostrecke, die mich sofort fesselte. Die Bilder gehörten zu einem
Artikel über eine spektakuläre Fluchtaktion. Ich konnte einen Lastwagen
erkennen sowie eine riesige klappbare Leiter, die über eine Mauer
geworfen war. Unverkennbar handelte es sich um den „antifaschistischen
Schutzwall“, der seit August 1961 zum Grenzbefestigungssystem der DDR
gehörte, die von vielen Bürgern im Westen einfach nur „Zone“ genannt
wurde. Die innerdeutsche Grenze war 1.378 Kilometer lang. 1965 waren
Grenze und Mauer aber noch nicht durch Minenfelder und
Stacheldrahtrollen fast unüberwindbar geworden, und auch der
Schießbefehl lag noch in weiter Ferne (er wurde erst 1982 formell in ein
Gesetz gefasst). Aus diesem Grund war an ausgesuchten Stellen eine
Flucht über Lkw und Klappleiter, wenn auch mit hohem Risiko verbunden,
noch möglich. (…)
Plötzlich hielt ich inne.
Das konnte doch nicht wahr sein. Ich hielt mir das Magazin direkt unter
die Nase. Doch, kein Zweifel. Einer der Fluchthelfer war unverkennbar
Manfred, auch wenn er in der Bildunterschrift nicht namentlich genannt
wurde. Der Manfred, der mir jetzt gegenübersaß und uns beiden in
abgestoßenen Tassen den frischgebrühten Kaffee einschenkte. Manfreds
Gesicht, gestochen scharf. Das Foto war aufgenommen worden, als er einer
Person beim Herunterklettern von der Leiter auf westlicher Seite half.
Das ergab Sinn, denn in einer solch angespannten Situation konnte ein
Flüchtling aus Angst leicht danebentreten und sich schwer verletzen.
„Manfred, das bist ja du auf dem Foto!“, rief ich erstaunt aus. (…)
„Ich bin Fluchthelfer“,
erklärte mein Freund schlicht. „Wie? Fluchthelfer? Das musst du mir
genauer erklären.“ Manfred erzählte, dass er es als wichtige Aufgabe
empfand, Menschen aus der DDR, die dort nicht mehr leben wollten, zur
Freiheit zu verhelfen. Und nach einigem Zögern fügte er hinzu: „Ich
hatte als Tunnelbauer angefangen, aber unser letzter Tunnel ist leider
aufgeflogen.“ Ich war Feuer und Flamme. Und tief beeindruckt. Das klang
alles nach einem einzigen großen Abenteuer, nach einem, bei dem Menschen
geholfen wurde! (…)
Erst viel später fand ich
in Gesprächen heraus, dass diese Einzelpersonen der CDU nahestanden oder
gar Parteimitglieder waren, darunter vermutlich Ernst Lemmer, von 1964
bis 1965 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und
Kriegsgeschädigte, und Fritz Amrehn, ein Berliner Abgeordneter, die
beide die Fluchthilfe politisch unterstützen wollten. Der größte
gespendete Betrag betrug 30 000 DM, das war damals eine Menge Geld.
Dahinter verbarg sich der sogenannte Geheimfonds des Bundesministeriums
für gesamtdeutsche Fragen – bei ihm mussten bewilligte Gelder nicht
gegenüber der Öffentlichkeit gerechtfertigt werden. Er wurde von der
Regierung benutzt, um letztlich Fluchthilfeaktionen zu unterstützen. (…)
Als Corpsstudent hatte ich
ja auch den „Comment“ akzeptiert, unsere Regeln, die einzuhalten waren,
und wenn man gegen sie verstieß, hatte das Konsequenzen. Verbindlichkeit
auf freiwilliger Grundlage bedeutete mir schon damals viel – und tut es
heute noch. So hatten ältere Studenten sich um die jungen, die
„Füchse“, zu kümmern, sie wenn nötig zu beschützen. Das war ein Aspekt,
der mir gut gefiel. Es gab aber noch etwas, was mir durch den Kopf ging,
und das sprach ich ebenfalls an. Der arme Manfred, ich hatte ihn ganz
schön in der Zange. „Wenn die Tunnelunternehmungen nur bedingt zum
Erfolg geführt haben, ist deren Zeit dann nun vorbei?“ Immerhin dauerten
die Grabungen Monate, so viele Personen, die im Dreck lagen und
buddelten, waren in sie involviert, und überhaupt: Wie und wo lagerte
man die immensen Erdmassen zwischen? Dazu brauchte man doch Raum. Und es
war zudem zu befürchten, dass nach jeder aufgeflogenen Aktion die
DDR-Grenzer bestimmte Aktivitäten genauestens beobachteten. Wie oft
hatte ich Fotos in Zeitungen gesehen, in denen die Grenzer mit riesigen
Ferngläsern alles unter die Lupe nahmen. Aber sie waren bestimmt nicht
nur optisch auf dem neuesten Stand, ich konnte mir gut vorstellen, dass
auch ihre Ohren geschult waren und sie jedes fremde akustische Signal
orten konnten. (…)
Ich war bereit, bei der
Flucht zu helfen. Aber würde ich im Fall des Falles eine Waffe
gutheißen? Ich dachte an die Duelle in der Verbindung. Für mich war das
studentische Mensurfechten in erster Linie eine Tapferkeitsprobe. Mehr
Sport als Kampf. Wobei ich zugeben muss, dass das Fechten in der
studentischen Variante für den Außenstehenden schon etwas sonderbare
Aspekte aufweist, etwa, dass man nie ausweichen oder wegzucken darf.
Letztlich geht es um eine Mutprobe und um einen Solidaritätsbeweis. Ich
genoss das Fechten an sich, viele andere taten es, weil es der nicht
verhandelbare Preis für die Vollmitgliedschaft in der Verbindung war.
Umso besser, wenn man Spaß daran hatte. Und das hatte ich. Aber eine
Waffe tragen, eine Schusswaffe, das war etwas ganz anderes. Wie weit man
sich da unter Kontrolle hatte, wenn es gefährlich wurde, das konnte ich
nicht mit Gewissheit beantworten. Ich wusste nur, dass ich mit Waffen
nichts zu tun haben wollte. Die politische Situation Westberlins
beschäftigte mich sehr und ich hatte das Gefühl, am Puls der Geschichte
zu leben. Und jetzt bot sich mir die Möglichkeit zu handeln. Gab es eine
finanzielle Motivation? Nein. Von meinen Eltern bekam ich monatlich
einen Scheck, und der reichte aus, um mein Studentenleben zu bestreiten.
Eine humanitäre Motivation? Ja, die war unzweifelhaft gegeben, gemischt
mit einer gehörigen Portion Abenteuerlust. Ich war jung, die Welt stand
mir offen – und ich wollte etwas verändern.
Und dann hörte ich mich zu
Manfred zwei Sätze sagen, die mein Leben verändern sollten: „Ich möchte
bei euch mitmachen. Auf mich könnt ihr zählen.“ Als die Worte über meine
Lippen gekommen waren, war ich selbst etwas überrascht. Manfred schwieg
erst und sah mich dann eindringlich an. „Bist du dir über die möglichen
Konsequenzen im Klaren?“ „Klar doch“, erwiderte ich mit fester Stimme.
„Ist dir auch bewusst, dass man dich nicht einfach aufnimmt? Man wird
dich auf Herz und Nieren prüfen.“ „Alles andere wäre auch
unverantwortlich“, gab ich zurück. „Manche denken aber, dass sie gleich
an so etwas Spektakuläres wie einen Tunnelbau rangelassen werden.“ Ich
hob die Schultern. „Ich lasse mich überraschen.“ „Gut, ich wollte es dir
nur gesagt haben.“ „Und wie werde ich getestet?“ Das fand ich nun
spannender. „Du wirst jemanden in Ostberlin aufsuchen, dem du dann eine
chiffrierte Nachricht übermittelst. Das sind einfache Botengänge, auch
Kurierdienste genannt.“ „Weiß ich, was das für Nachrichten sind?“ „Meist
nicht. Aber manchmal geht es auch nur darum nachzufragen, ob derjenige
noch Interesse hat.“ „Wieso Interesse?“ „Na ja, ob er noch rüber will.
Diese Aktionen haben ja einen langen Vorlauf, in der Zwischenzeit kann
der eine oder andere seine Meinung geändert haben.“
Viele der unerfahrenen
Kuriere, erfuhr ich weiter, wurden bei ihrem ersten Einsatz gefasst.
Professionelle Fluchthelfer, die dieses Geschäft aus rein kommerziellen
Gründen betrieben, missbrauchten Studenten, die eine gewisse
Begeisterung und Bereitschaft an den Tag gelegt hatten, dann aber nicht
oder nur unzureichend instruiert wurden. Und gerieten sie in eine
schwierige Situation, mussten sie sie ohne Hilfe lösen. In Berlin und
generell in der DDR gab es kaum öffentliche Telefone, von denen aus man
in den Westen hätte anrufen können. Und die wenigen, bei denen es
möglich war, wurden mit Sicherheit überwacht. Wer als Fluchthelfer in
der DDR operierte, musste sich darüber im Klaren sein, dass er
vollkommen allein auf sich gestellt war.
„Willst du mich abschrecken?“, fragte ich. „Nein“, erwiderte Manfred. „Aber du sollst wissen, worauf du dich einlässt.“